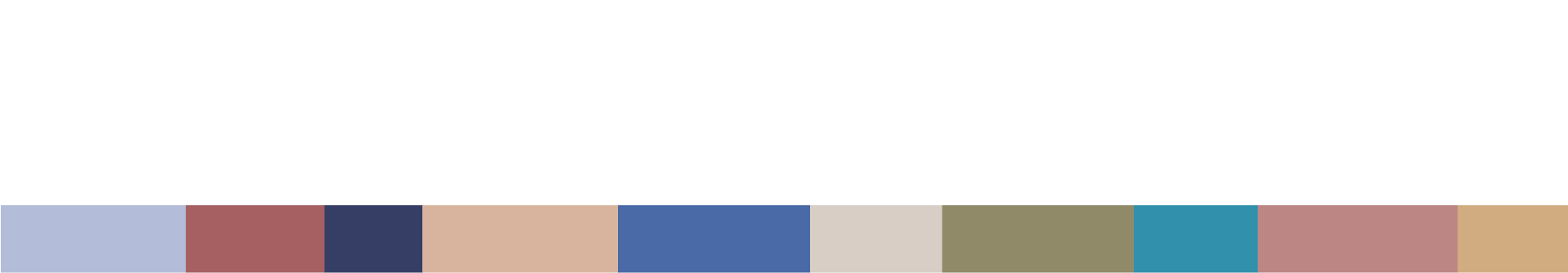Wer hat nicht als Kind Tage damit verbracht, in einer entlegenen Ecke des Gartens oder sogar im nahen Wald einen Unterschlupf zu bauen und vorzugeben, auf einer einsamen Insel gestrandet zu sein und nun ganz alleine überleben zu müssen? Sicher steckt eine solche Kindheitsfantasie hinter dem kleinen Büchlein Als Robinson im Zelt (1955), das Kinder in die Kunst des Zeltens einführt. Es nutzt die Robinson-Geschichte als eine Gelegenheit, Informationen über das Campen zu geben: es enthält nützliche Tipps, erzählt persönliche Anekdoten, und zeigt in Illustrationen, wie man ein Zelt errichtet oder ein Feuer entfacht.
Als ein Beispiel für Kinder- und Jugendliteratur – eine Gattung, zu deren Entstehung gerade Umschreibungen von Robinson Crusoe substanziell beigetragen haben – ist dieses Büchlein ebenso unterhaltsam wie lehrreich. Die Geschichte folgt dem gattungstypischen Muster: die Protagonisten verlassen die Sicherheit des Heims und begegnen einer Reihe herausfordernder Abenteuer, bevor sie letztlich wieder nach Hause zurückkehren, reifer und klüger als zuvor (siehe O’Malley, 93–94). Dieses Buch für Kinder beginnt auf recht literarische Weise: es stellt seinen jungen Leserinnen und Lesern die (nur recht unvollständige) Publikationsgeschichte von Daniel Defoes Klassiker vor und zeichnet den Charakter Robinson Crusoes als ein Vorbild, dessen Leben in der Natur dem in einer industrialisierten Stadt vorzuziehen ist. In vereinfachender Weise vertritt das Buch damit das Motto ‚Zurück zur Natur‘, das der französische Aufklärungsphilosoph Jean-Jacques Rousseau zuerst als Kernaussage des Romans identifizierte.
Die Vision eines Lebens im Gleichklang mit der Natur, die das Büchlein zeichnet, beinhaltet auch Verweise auf das Leben von Nomadenvölkern. Diese Bezüge sind mitunter problematisch, wenn die Kultur solcher Völker mit einfacheren, ja sogar vor-zivilisatorischen Lebensweisen verglichen werden. Im Gegensatz dazu schafft das Buch ein Gefühl der Vertrautheit für seine (Schweizer) Leser:innen, indem es eine Sprache verwendet, die inklusiv scheint aber stillschweigend Ausgrenzungen vollzieht: so heisst es, ‚erst einmal bauen wir ein Zelt‘ oder man liest von ‚unserem Zeltplatz‘, ohne jedoch zu erwähnen, dass die dafür notwendigen Praktiken und das Können von nomadischen Zivilisationen erlernt wurden. Dass das Büchlein auf diese Weise eine schweizerische Identität und eine Kultur des Draussen-Seins hervorhebt, lässt sich mit der damals noch ausgeprägt patriotischen Philosophie des Verlags Schweizerisches Jugendschriftwerk erklären.
Während Robinson Crusoe als Inspirationsquelle für Titel und Geschichte des Buches lieferte, besteht der Inhalt hauptsächlich aus Anleitungen und Hinweisen dazu, wie man einen guten Rastplatz findet, wie man ein Zelt aufbaut, wie man das Wetter aus dem Wolkenhimmel abliest, und vieles mehr. Diese Anleitungen werden von Illustrationen begleitet, die wie in einem Handbuch verdeutlichen, was der Text erklärt. Manchmal dienen die Schwarz-weiß-Zeichnungen auch dazu, kleine nostalgische Einlassungen des Erzählers zu illustrieren. Zusammen mit den hilfreichen Tipps dienen die romantisierenden persönlichen Anekdoten über das Zelten dazu, Lust auf ein eigenes Abenteuer zu machen.


Alles in allem bietet Als Robinson im Zelt eine abwechslungsreiche Darstellung all dessen, worauf man beim Campen in der freien Natur achten sollte. Robinson Crusoe wäre wohl sicher dankbar gewesen, wenn er neben der Bibel auch eine Ausgabe diese Büchleins auf dem Wrack seines Schiffs gefunden hätte – und wahrscheinlich hätte er wenig Probleme mit den stereotypen kolonialistischen Sichtweisen gehabt, die sich noch 1955 in einem Kinderbuch finden.
Text: Naomi Wolter
Übersetzung: Isabel Karremann
Quellen:
- Knobel, Bruno. Als Robinson im Zelt (Nr. 518). Illustriert von Gunther Schärer. Zürich: Schweizerisches Jugendschriftenwerk, 1955.
- O’Malley, Andrew. “Crusoe’s Children: Robinson Crusoe and the Culture of Childhood in the Eighteenth Century.” In The Child in British Literature, ed. by Adrienne E. Gavin. London: Palgrave Macmillan, 2012, 87–100.